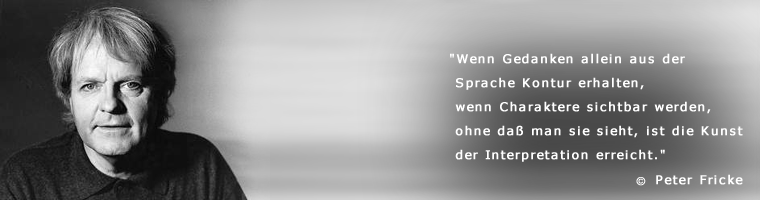Und nieder mit ihren Verächtern: Sie ist der Maßstab, den unsere Zivilisation nicht verlieren darf.
In Deutschland blüht die Hochkultur. Wieder ist eine Saison mit glänzenden Inszenierungen und Konzerten, großen Ausstellungen und erregten Podiumsdiskussionen zu Ende gegangen, haben Eltern ihre Kinder bei Musikschulen angemeldet oder zum Besuch eines altsprachlichen Gymnasiums animieren können. Auch wenn die Kommunen bisweilen unter der Last der Finanzierung ächzen, das eine oder andere Theater schließen oder traditionsreiche Sinfonieorchester zusammenlegen – es gibt eine Theater-, Opern-, Musik- und Museenlandschaft, die in ihrer Vielfalt und Breite in der Welt ihresgleichen sucht.
Und doch würde kaum jemand wagen, diese blühende Bildungs- und Unterhaltungslandschaft noch unter dem Begriff Hochkultur zusammenzufassen. Er würde zwar kein Verständnisrisiko eingehen – jeder weiß, was damit gemeint beziehungsweise nicht gemeint ist: die neue Henze-Oper, aber nicht der König der Löwen, der neue Roman von Philip Roth, aber nicht der neue Thriller von Dan Brown. Gleichwohl ist es üblich geworden, sofort die beschwichtigende Relativierung hinterherzuschicken, dass die Abgrenzung zu Pop- und Massenkultur längst hinfällig geworden sei. Gestandene Literaturkritiker haben schon einen neuen Dan Brown mit derselben Ausführlichkeit gewürdigt wie einen Martin Walser – als sei es die vornehmste Pflicht der Kritik, den Unterschied von Kommerz und Kunst zu verwischen.
Selbst wer aus eigener Erfahrung weiß, dass es niemals möglich sein wird, einen Elton-John-Song so oft und so genau zu hören wie eine Beethoven-Sonate, selbst wer mit der Hochkultur einen vertrauten und dünkelfreien Umgang pflegt, wird von geradezu panischer Furcht beherrscht, man könne ihm diesen Umgang und erst recht die Vertrautheit als Dünkel auslegen. Woher die Scham, was verbietet es, sich zu einer Kunst zu bekennen, die nicht zuallererst auf den Massenabsatz zielt?
Gewiss kann auch ein Beethoven-Konzert beliebig schlecht sein. Die Rede von der Hochkultur bedeutet aber keine Qualitätsaussage. Sie formuliert zunächst nur einen Anspruch, der im Übrigen auch nichts mit der obskuren Trennung zwischen E und U, zwischen den ernsten und den unterhaltenden Künsten, zu tun hat, die tatsächlich in die Irre führt. Denn es ist ja nicht so, dass die Massenkultur ohne ernsthafte Stoffe auskäme; Liebe, Tod und letzte Dinge sind geradezu die Voraussetzung für eine erfolgreiche Kitschproduktion. Und umgekehrt werden eine Beethoven-Sonate oder ein Roman von Philip Roth von ihren Verehrern keineswegs widerwillig heruntergewürgt, sondern versprechen ihnen hohen Unterhaltungswert, nur freilich auf einem anderen Niveau, der Komplexität, aber auch der Bildung, die sie voraussetzen. Für die einen ist Philip Roth zu kompliziert, um unterhaltend zu sein; für die anderen Dan Brown zu simpel. Das ist alles, aber wahrscheinlich auch schon der Kern des Skandals. Der Begriff der Hochkultur sortiert das Publikum.
In einer Demokratie werden Unterscheidungen von hoch und niedrig nur ungern gesehen. Auch wenn sie mit dem sozialen Gefälle nichts zu tun haben, lenken sie doch den Blick darauf, dass nicht überall alles relativ ist, und gefährden damit den besänftigenden Konsens, dass auch in den Künsten letztlich keine Frage des Niveaus, sondern nur des Publikumsgeschmacks berührt werde – was dem einen sein Philip Roth, ist dem anderen sein Dan Brown, basta. Offenbar ist es leichter, sich mit finanziellen als mit intellektuellen Unterschieden zu versöhnen. Wo es nicht um Geld geht, wird es in der Demokratie gefährlich. Geld kann, so das allgemein akzeptierte, den sozialen Frieden sichernde Märchen, jeder machen. Aber selbst wer an das Märchen der Chancengleichheit glaubt, wird es nicht auf die Bezirke von Bildung und geistigem Anspruch ausdehnen. Sie liegen schon auf jenem anstößigen Gelände von Herkunft und zufälligen Privilegien des Umfelds, an dem bisher noch jede Sozialpolitik scheiterte. Sie führen aber andererseits auch nicht auf das Feld von Glamour und Prestige, das die Fantasie der Massen beflügelt.
Hochkultur ist nichts für die Superreichen, denen man alles gönnt, weil sie jenseits aller Maßstäbe siedeln. Für sie gilt noch immer, was schon Marx erkannt und Proust in die Formel gegossen hat: dass sie in ihrer Unbildung mit den Ärmsten auf einer Stufe stehen. Die große abendländische Kulturtradition und ihre zeitgenössischen Erben richten sich an jene brave Mittelschicht, aus der die Denker und Dichter, aber noch nie Glanz und Sex-Appeal gekommen sind. Das ist der Grund, warum neben dem Geruch des Elitären die Hochkultur auch das Odium des Spießigen hat.
Wie anders die Popkultur! Sie wird nicht nur von jedem verstanden, sie entfaltet auch den ersehnten Glanz. Darum gibt es die Museumsleute und Regisseure, die um jeden Preis dem gusseisern Seriösen, dem Bürgerlichen der Hochkultur entkommen wollen. Das Ergebnis ist jene Eventkultur, die auch einer Ausstellung, einer Theaterinszenierung den Klatschfaktor und das Gepräge einer Party geben möchte. Die Kunst selbst genügt ihnen nicht mehr, es müssen auch eine exotische Location für die Ausstellung und Fernsehprominenz für die Inszenierung gefunden werden. Nirgendwo manifestiert sich das Misstrauen gegen die Hochkultur deutlicher als dort, wo ihre angestellten Verwalter selbst nicht mehr an sie glauben.
Das Misstrauen hat aber auch ökonomische Gründe, die politisch wirksam werden. Köln hat gerade seinen Kulturetat um 12,5 Prozent zusammengestrichen; aus den Niederlanden sind weit radikalere Zahlen bekannt. Der Rechtspopulist Geert Wilders erklärte dort, die Hochkultur sei nur für reiche Intellektuelle, warum sollte der Staat für sie zahlen? Dass Intellektuelle in der Regel nicht reich, und die Reichen nicht intellektuell sind, widerlegt seinen Punkt leider nicht. Es ist folgender: Weder die Henze-Oper noch der Bücherbus können sich aus eigener Kraft am Markt halten. Sie werden kräftig subventioniert, und zwar mit Steuergeldern, die von allen eingesammelt, aber nicht für alle ausgegeben werden. Die Nutzer sind nicht die Ärmsten der Armen, sondern die bildungswillige Mittelschicht, zu deren Gunsten die Umverteilung geschieht. Das ist kein Fehler des Staates; es ist nur leider so, dass er zwar Bildungschancen für alle, aber nicht den Bildungswillen aller organisieren kann.
Der Skandal, der darin liegt, wird gerne mit dem Beispiel der Massenkultur illustriert, die ganz ohne Subvention weit mehr Leute erreicht. Warum kann sich nicht auch eine Oper frei am Markt finanzieren? Der egalitäre Hass auf die Hochkultur verbündet sich hier mit dem Denken der Unternehmensberater: Bolschewismus von rechts.
Vorübergehend wäre ein privater Opernbetrieb sogar denkbar; dabei käme wohl so etwas heraus wie die Baden-Badener Festspiele, ein glänzender Cocktailanlass für die Mäzene, aber unbezahlbar für breite Kreise. Lange würde sich das Spektakel indes nicht halten, denn auch die glanzvollen Inszenierungen der etablierten Festspiele fußen auf dem ganz normalen Opernbetrieb, den die Subventionierung der staatlichen Bühnen möglich macht. Wo sollten die Orchester, die Sänger, die Bühnenbildner herkommen, wenn sie nur ein paarmal im Jahr engagiert würden?
Selbst in der frei finanzierten Kultur steckt noch immer eine Menge unsichtbaren Steuergeldes. Gewiss gibt es Leute, die vor einem Privatpublikum Alfred Brendel auftreten lassen – fraglich ist allerdings, ob Alfred Brendel jemals der große Pianist geworden wäre ohne die Kulturmaschinerie des Staates, von den Musikschulen, an denen die Talente entstehen, bis zu den Orchestern und Dirigenten, mit denen ein Brendel spielt, die seine Verehrer aber niemals für ihn alleine alleine aus dem Boden stampfen könnten.
Offenbar ist vergessen worden, zu welchem Zweck der moderne Staat in die Pflege der Hochkulturstätten eingesprungen ist, die einst an den Fürstenhöfen entstand. Es waren nicht nur die Bürger, die etwas von ihnen Geschätztes von ihrem Geld haben wollten. Es war seit Beginn des vorigen Jahrhunderts die Aufstiegshoffnung der Arbeiterbewegung, die sich in der berühmten Formel niederschlug: die Höhen der bürgerlichen Kultur stürmen. Es war der sozialdemokratische Gedanke, dass die Klassenschranken dort niedergerissen werden müssten, wo sie den Zugang zum Mitdenken und Mitreden versperrten. Die Teilhabe an der Hochkultur sollte die politische Teilhabe vorwegnehmen.
Mit dem Emanzipationsgedanken kam indes auch das Pädagogische, Pflichtmäßige, wenn nicht sogar politisch und gesellschaftlich Verpflichtende in den Umgang mit der Kultur. Selbst Kunst, die einmal ein großer Spaß, ein ästhetischer Genuss und Gedankenabenteuer war, wurde zu einer sportlichen Übung, die Disziplin, wenn nicht Überwindung verlangte. Noch heute hat es etwas Absurdes, wenn der satirische Überspaß einer Rossini-Oper (eine Art höherer Nonsens in musikalischer Gestalt) oder der schon wesentlich subtilere Humor einer Mozart-Oper oder der erhebende Tränengenuss, den Verdis Rigoletto bereitet, als etwas gesehen wird, das zu Zwecken des sozialen Aufstiegs oder zur Verteidigung des erreichten Status genossen werden muss. Nichts davon ist jemals dafür gedacht worden, einem innerlich abgeneigten Publikum als bittere Pille der Bildung zu dienen; vieles ist seinerzeit tatsächlich einem freien Markt mühsam abgerungen worden. Als Rossini sich einmal bei seinem Impresario über den Lärm des Roulettes beschwerte, der aus dem angegliederten Casino bis auf die Opernbühne drang, antwortete dieser: Da wird gerade Ihr Honorar verdient.
Und doch ist der Bildungsgedanke nicht falsch. Es geht aber weniger um die soziale Praxis als um den intellektuellen Maßstab, der durch die Pflege der Hochkultur im Umlauf gehalten wird. Der Maßstab zeigt, auf welchem geistigen und ästhetischen Niveau die entscheidenden Momente menschlicher Existenz gedacht, gestaltet und in leuchtende Bilder überführt werden können. Es ist der Maßstab, von dem unsere Zivilisation lebt und ohne den die Gegenwart sofort vergessen würde, in welcher Gedankentiefe der Mensch seine Angelegenheiten spiegeln kann, sein privates Leben ebenso wie seine politischen Verhältnisse.
Als Maßstab ist die Hochkultur tatsächlich keine Frage der Qualität ihrer Ausübung: Der Unterschied zwischen Nigel Kennedy und einer Geigerin wie Hilary Hahn liegt nicht in den virtuosen Fähigkeiten. Kennedy spielt, was sich auf dem Markt verkaufen lässt; Hahn sucht mit äußerster Anstrengung des Geschmacks und der Interpretation aus den Noten herauszuholen, was in ihnen steckt und noch heute zu uns spricht (und sich dann hoffentlich auch verkauft).
Die Anschauung dieses Maßstabs nur den Happy Few zugänglich zu machen, würde jeden Gedanken an eine Emanzipation bildungsferner Schichten zunichte machen; ihn umgekehrt gänzlich verfallen zu lassen käme einer vollständigen Verwahrlosung, übrigens auch historischen Desorientierung gleich. Es muss möglich sein, und zwar für jedermann, den Weg zu ermessen, den die Kunst von Velásquez bis Rothko zurückgelegt hat; wer ihn nicht kennt, weiß weder, aus welcher Welt wir kommen, noch, in welcher wir heute leben.
Selbst die Popkultur lebt von Mustern der Hochkultur. Das Spiel mit Traditionen und Zitaten, das längst die populäre Musik erreicht hat, und erst recht das intellektuelle Niveau der Popkritik, verdankt sich der Einwanderung und Übernahme der Gedankenfiguren, die sich an der Hochkultur erprobt haben. Man denke sich nur einmal die philosophischen Lehrstühle der staatlichen Hochschulen Frankreichs weg, von denen die Popkritik ihre verzwickten Gedankengänge bezogen hat, und frage sich, was von ihr übrig bliebe – wenig mehr als das berühmte »Gefällt mir/Gefällt mir nicht« des Internets.
Das eigentliche Wunder der Hochkultur und ihres innersten Kerns, der Künste, besteht in ihrer Übertragung bis in die letzten Winkel der Unterhaltungsindustrie hinein. Noch in dem dämlichsten Song lebt eine Modulation, die das 18. Jahrhundert fand, noch in der Bildkomposition eines Trivialfilms findet sich ein Reflex der alteuropäischen Tafelmalerei. Es reicht aber nicht, sich damit zu genügen, dass sie solcherart fortleben; das Wunder wird sich nicht wiederholen, wenn die Vorbilder und ihr Maßstab nicht mehr zugänglich sind.
Das kann aber kein Markt finanzieren: den Kunst- und Gedankenvorrat der Vergangenheit zugänglich zu halten und die zeitgenössische Fortsetzung zu ermöglichen. Und schon gar nicht kann der Markt die Wunder der Hochkultur bereithalten für den Moment, da ein Mensch, der von ihr sonst ausgeschlossen bliebe, sie sich erschließen will. Darum werden die Subventionen keineswegs nur zum Bestandschutz eines privilegierten Publikums gezahlt, sondern für die Freiheit eines jeden, aus seiner selten selbst verschuldeten, sondern gesellschaftlich bedingten Unmündigkeit auszubrechen. Darum ist es richtig, die Bedürfnisse höherer Bildung privilegiert zu erfüllen: weil diese Bedürfnisse in jedem schlummern.